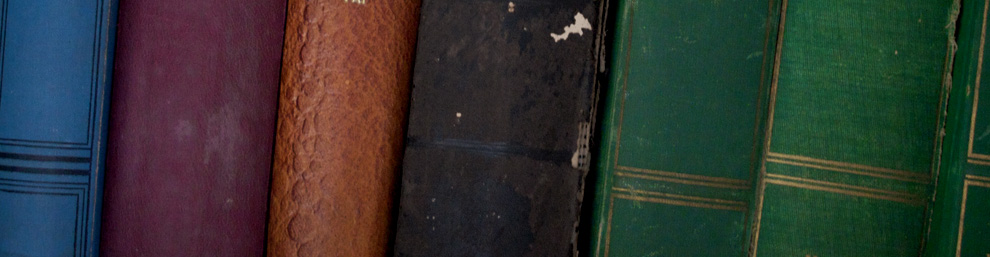Heute veröffentlicht das „Süddeutsche Zeitung Magazin“ ein Interview mit Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen und der Schauspielerin Maria Furtwängler. Es ist beeindruckend, wie offen beide Frauen über die Demenzerkrankung ihres Vaters sprechen. Sie sprechen Erfahrungen aus, die wohl viele Menschen machen, die einen an Demenz Erkrankten betreuen und pflegen müssen: Den Drang, alles zu kontrollieren; manchmal auch die Scham über das – zunächst unverständliche und unerklärliche – Handeln des Kranken; die Notwendigkeit, zu bestimmten Handlungen anzuregen, etwa in der Körperpflege; die schwierige Notwendigkeit, diesen unumkehrbaren Prozess für sich selber zu akzeptieren.
Für mich sind drei Gedanken wichtig und ich möchte sie mit meinen eigenen Gedanken und Erfahrungen dazu unterstreichen:
1) Es ist notwendig, sich über die Demenzerkrankungen zu informieren. Wissen bedeutet schon eine unglaubliche Entlastung, weil man die Krankheit in ihrem Verlauf besser versteht und vieles nicht mehr persönlich nimmt.
2) Es ist notwendig, wenn auch schwierig, einen Perspektivewechsel vorzunehmen: nicht mehr darauf zu schauen, was der Betreffende nicht mehr kann (das springt meistens schnell ins Auge), sondern auf das zu achten, was der Demenzkranke immer noch kann: fühlen und spüren, lachen, traurig sein, reden, essen, etc… (es ist ja „nur“ das Gehirn betroffen, nicht der ganze Mensch!)
3) Es ist irgendwann einmal notwendig, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen; denn die Belastung steigt unweigerlich immer mehr an und führt irgendwann einmal zum Gefühl des Ausgebranntseins. Dann kann es zu Reaktionen kommen, die niemand eigentlich will und die man später bereut. Hilfe ist vielfältig möglich: Essen auf Rädern, medizinische und pflegerische Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst bis hin zur Aufnahme in ein Seniorenheim, welches die Beziehung spürbar entlastet und befriedet.
Schließlich weist Frau von der Leyen darauf hin, dass wir in der Begleitung der Demenzkranken drei Säulen brauchen: die Familien, die professionelle Pflege und auch das nachbarschaftliche und ehrenamtliche Engagement.
Beide Frauen berichten davon, wie sehr sie selbst durch die Erkrankung ihres Vaters verändert worden sind. Frau Furtwängler sagt, sie habe gelernt, dass sie nicht mehr so perfekt sein müsse.
Deshalb möchte ich mit dem Hinweis auf dieses lesenwerte Interview Mut machen, die eigene Hilflosigkeit und die eigenen Defizite anzunehmen. Das ist vielleicht auch noch ein Dienst, den die Demenzkranken uns, den (noch) Gesunden, leisten.