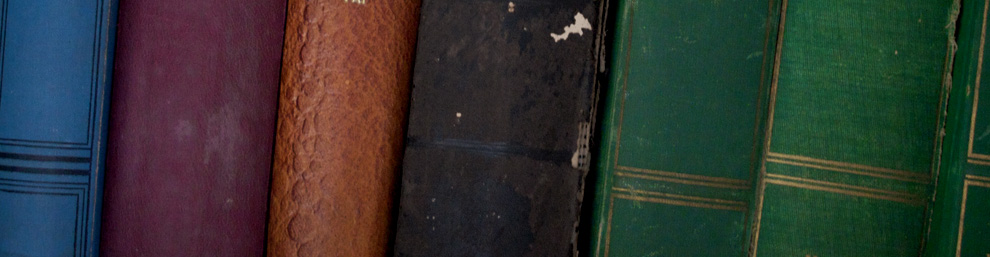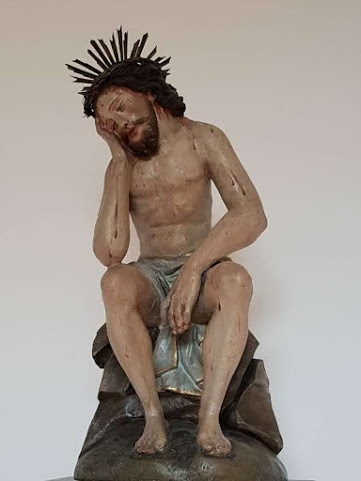Gestern war im „Mühldorfer Anzeiger“ ein Bericht über das Projekt Märchenland, das im AWO Seniorenheim in Waldkraiburg durchgeführt wurde. Dabei hat die professionelle Märchenerzählerin Julia von Maydell den Bewohner*innen das Märchen vom Froschkönig (und andere) erzählt.
Der Zeitungsbericht erwähnt auch die Studie „Es war einmal … Märchen und Demenz“. Diese zehn Jahre alte Studie ist sehr interessant und lesenswert. Die Märchen weckten bei den Senior*innen viele Erinnerungen, es gab ein Wiedererkennen von alten und vertrauten Geschichten. Ein textsicherer Umgang der Erzählerin, gepaart mit einigen Requisiten wie etwa Speisen (z.B. Honig), etwas zum Tasten (z.B. ein Fell), etwas zum Anschauen (z.B. Bilder oder ein Mantel) oder auch Musik ermöglichten es den Zuhörern, leichter in das Märchen einzutauchen. Es wurden verschiedene Sinne stimuliert und das führte dazu, dass die Teilnehmer sehr viel Freude empfanden, die auch noch lange anhielt.
Mich hat dieser Bericht und die Studie dazu angeregt, zu überlegen, ob Märchen nicht auch einen guten Platz in einem Seniorenclub haben könnten. Und ich bin davon fest überzeugt!
Man braucht vielleicht/ bestimmt keine professionelle Erzählerin, wohl aber eine gute Vorbereitung. Welches Märchen könnte attraktiv sein? Ein sehr bekanntes mit Wiedererkennungseffekt oder ein eher unbekanntes mit einem Spannungspotenzial? Welche Materialien können eingesetzt werden (evtl. auch durch andere – etwa einen oder mehrere Musiker, wie es die Zangberger schon mal gemacht haben)? Wieviel Zeit darf es in Anspruch nehmen (es reicht wohl eine eher kurze Spanne und muss nicht ein ganzer Nachmittag sein!).
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Seniorinnen selbst ins Erzählen kommen. Etwa ihr Lieblingsmärchen vorstellen (wenn es das gibt) oder eines, das in ihrer Kindheit immer wieder erzählt wurde. Dann wird es mit ziemlicher Sicherheit auch einen Austausch geben zwischen den Teilnehmerinnen des Seniorenkreises. Und der wird wohl auch lebhaft sein, mit viel Freude, mit einigen Aha-Erlebnissen, mit Langzeitwirkung.
Märchen gehen ja immer gut aus, auch wenn es zwischendurch Krisen und Kämpfe zu bestehen gilt. Damit können Märchen dann auch helfen, das eigene Leben zu verstehen wie ein „Märchen“. Dass die Krisen des Lebens gut ausgehen werden. Das Hoffnungspotenzial entdecken. Aber das ist ein Aspekt, den man gar nicht anzielen braucht. Das wäre schon fast ein zu hoher Anspruch. Im Vordergrund steht vielmehr die Freude, das gemeinsame Erinnern, der Ratsch darüber, eine frohe Stunde. Dazu möchte ich gerne Mut machen und Neugier wecken und zum Ausprobieren anregen.
Wer die Studie lesen will, findet sie unter folgendem Link: https://maerchenunddemenz.de/forschung/maerchen-demenz-studie/